Die Stadt-Kegelmeisterschaft werden wir wohl noch nicht gewinnen, aber wir lernen schnell. Allerdings stand bei unserem Kegelausflug zu Benthaus-Büchner auch nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern der Spaßfaktor!

Menschen, willkommen in Waltrop!
by Redaktion
by Redaktion

Trotz verschiedener Proteste und Warnungen von Rechtsexpertinnen, Flüchtlingsorganisationen, dem DIMR und vielen mehr trat am 29.11.2016 die Verordnung zur Wohnsitzregelung für schutzberechtigte Flüchtlinge in NRW in Kraft. Viele andere Bundesländer haben sich gegen die Einführung der durch das Integrationsgesetz ermöglichten bundeslandinternen Wonsitzzuweisung entschieden. Nach Bayern und Baden-Württemberg kann jetzt auch in NRW anerkannten Asylbewerberinnen der Wohnort innerhalb des Bundeslandes vorgeschrieben werden. Zuständig hierfür ist die Bezirksregierung Arnsberg. Die Landesverordnung sieht eine Zuweisung mit Wohnsitzverpflichtung für drei Jahre auf Grundlage eines umstrittenen Integrationsschlüssels(Arbeitslosenquote, Anrechnung EU-Zuwanderung …) vor. Schon allein diese Tatsache widerspricht einem Urteil des Europäischen Gerichtshof aus März diesen Jahres. Bei anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Geschützten muss der Zuweisung nämlich eine individuelle Prüfung der Integrationsprognose unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände vorausgegangen sein.
In einer Pressemitteilung vom 22.11.2016 erklärt die Landesregierung, dass sie mithilfe der Wohnsitzauflage die Integrationsarbeit der Städte und Gemeinden in NRW unterstützen wolle. Aber auch die Interessenvertreterinnen der Kommunen sind sich in puncto Wohnsitzauflage nicht einig, wie der neuesten Ausgabe der Zeitschrift „Kommune“ zu entnehmen ist. Die Kommunen befürchten einen hohen Bürokratieaufwand und viele Rechtsstreitigkeiten.
DStBG: Wohnsitzauflage bleibt umstritten (15.11.2016) DStGB-Buchstabenwechsel
WDR: Wohnsitzauflage für Flüchtlinge startet heute (01.12.2016)
Quelle: Flüchtlingsrat NRW
by Redaktion
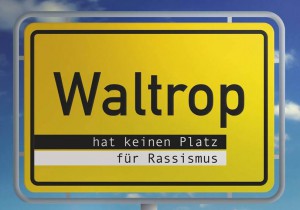 Seit 2002 gibt es die so genannten „Mitte-Studien“, die alle zwei Jahre repräsentative Erhebungen zu rechtsextremen Einstellungen sowie gruppenbezogenen Abwertungen in Deutschland zusammenfassen. Seit 2006 veröffentlicht die Friedrich-Ebert-Stiftung die Studie und stellte am Montag, dem 21.11.2016, die neuesten Ergebnisse unter dem Titel „Gespaltene Mitte, feindselige Zustände“ vor. Die Ergebnisse zeigen vor allem, dass sich die Gesellschaft weiter polarisiert: Rechte, neurechte und rechtsextreme Einstellungen nehmen zu, und eine rechtsextreme Minderheit radikalisiert sich zunehmend gefährlich. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland (56 %) spricht sich nach wie vor für die Aufnahme von Flüchtlingen aus, allerdings wollen 38 % der Befragten wollen eine Obergrenze für Flüchtlinge, während nur 21 % sie strikt ablehnen. Besonders stark ausgeprägt sind muslimfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung, Auch nehmen die Vorurteile gegenüber asylsuchenden Menschen weiter zu: von 44 % der Befragten im Jahr 2014 auf 50 % 2016.
Seit 2002 gibt es die so genannten „Mitte-Studien“, die alle zwei Jahre repräsentative Erhebungen zu rechtsextremen Einstellungen sowie gruppenbezogenen Abwertungen in Deutschland zusammenfassen. Seit 2006 veröffentlicht die Friedrich-Ebert-Stiftung die Studie und stellte am Montag, dem 21.11.2016, die neuesten Ergebnisse unter dem Titel „Gespaltene Mitte, feindselige Zustände“ vor. Die Ergebnisse zeigen vor allem, dass sich die Gesellschaft weiter polarisiert: Rechte, neurechte und rechtsextreme Einstellungen nehmen zu, und eine rechtsextreme Minderheit radikalisiert sich zunehmend gefährlich. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland (56 %) spricht sich nach wie vor für die Aufnahme von Flüchtlingen aus, allerdings wollen 38 % der Befragten wollen eine Obergrenze für Flüchtlinge, während nur 21 % sie strikt ablehnen. Besonders stark ausgeprägt sind muslimfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung, Auch nehmen die Vorurteile gegenüber asylsuchenden Menschen weiter zu: von 44 % der Befragten im Jahr 2014 auf 50 % 2016.
Die potentiellen Wählerinnen der AfD rücken stark nach rechts. 2014 werteten etwa rund 57 % von ihnen Asylsuchende ab, aktuell sind es 74 % – die Ablehnung gegenüber Musliminnen ist bei AfD-Anhängerinnen von 30 auf 43,5 % gestiegen. Andreas Zick, Professor an der Bielefelder Universität, Mitautor der Studie und Leiter des IKG, resümiert: „Deutschland befindet sich in einer Zerreißprobe: Während sich viele von rechtspopulistischen Meinungen leiten lassen und aggressiver gegen Eliten und vermeintlich Fremde geworden sind, sind andere bereit, sich noch mehr für die Integration zu engagieren.“
Der aktuelle BKA-Lagebericht bestätigt die Ergebnisse der neuen „Mitte-Studie“ über eine gefährlicher werdende Minderheit und warnt, dass neben Flüchtlingen zunehmend Helferinnen und Politikerinnen ins Visier der radikalisierten rechten Minderheit geraten. Seit Anfang 2016 wurden 212 Straftaten gegen Politikerinnen und 144 Straftaten gegen ehrenamtliche Helferinnen registriert. Es wurden im Vergleich zum Jahr 2015 etwas mehr Gewalttaten und Tötungsdelikte gegenüber Flüchtlingen festgestellt. Die Anzahl an Brandanschlägen ging hingegen stark zurück.
Zeitonline: BKA fürchtet Tote durch Angriffe von rechts (13.11.2016)
Quelle: Flüchtlingsrat NRW
by Redaktion
 Fachtagung des Flüchtlingsrates NRW: „(Schl)echte Bleibeperspektive – Kritik am politischen Konstrukt der Bleibeperspektive“
Fachtagung des Flüchtlingsrates NRW: „(Schl)echte Bleibeperspektive – Kritik am politischen Konstrukt der Bleibeperspektive“
Viele Interessierte aus Theorie und Praxis kamen am 19. November in die FH Dortmund, um bei unserer Fachtagung zur Kritik des politischen Konstrukts der Bleibeperspektive mitzumachen. Unter den 90 Teilnehmerinnen waren viele Aktive aus Flüchtlingsinitiativen, Mitarbeiterinnen der Wohlfahrtsverbände und Kommunen, Vertreterinnen der Refugee Law Clinics sowie Kulturschaffende. Durch die Mischung konnten verschiedene Blickwinkel beleuchtet werden, die sich auch in den Fachvorträgen widerspiegelten. Am Vormittag analysierten Referentinnen aus der Flüchtlingsberatungsarbeit sowie eine Rechtsanwältin die aktuelle Asylrechtslage und berichteten von den Auswirkungen der vielen Verschärfungen im Asylrecht auf ihre Arbeit in der Praxis. Im Fokus stand dabei die seit Herbst 2015 vorgenommenen Kategorisierung der Flüchtlinge nach Herkunftsland in Menschen mit sogenannter „guter“ und mit „schlechter Bleibeperspektive“. In mehreren Workshops wurde zu den Themenbereichen politische Aktion und Öffentlichkeitsarbeit, Rückkehrberatung, Perspektiven schaffen im Ehrenamt, Umgang mit Abschiebungen und Diskurse über Bleibeperspektive in den Medien gearbeitet. Die Entwicklung von Gegenstrategien stand im Mittelpunkt der Workshop-Arbeit.
Auf der Fachtagung wurde der Wunsch nach Vernetzung deutlich. Das macht Hoffnung, dass mit dem Potential vieler Akteurinnen in vielen Fällen dem politisch gewollten Ausschluss von Menschen mit sogenannter „schlechter Bleibeperspektive“ entgegengewirkt werden kann. Die Kategorie der „guten“ und der „schlechten Bleibeperspektive“ muss aus Gesetzgebung und Praxis verschwinden – nur so kann der momentan praktizierte Ausschluss von Teilhabe auf allen Ebenen verhindert werden. Dafür wollen sich der Flüchtlingsrat NRW und die Tagungsteilnehmerinnen auch in Zukunft einsetzen.
Quelle: Flüchtlingsrat NRW
by Redaktion
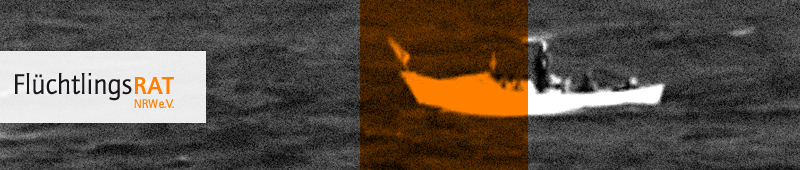 Gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin führt das BAMF seit Anfang dieses Jahres eine Befragung von geplant mehr als 4.500 erwachsenen Flüchtlingen durch, die im Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.01.2016 nach Deutschland gekommen sind. Die „IAB-BAMF-SOEP-Befragung“ soll Erkenntnisse über Wertvorstellungen, den Bildungsgrad, Erwerbsbiografien sowie Fluchtursachen und -erfahrungen von Flüchtlingen in Deutschland bringen.
Gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin führt das BAMF seit Anfang dieses Jahres eine Befragung von geplant mehr als 4.500 erwachsenen Flüchtlingen durch, die im Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.01.2016 nach Deutschland gekommen sind. Die „IAB-BAMF-SOEP-Befragung“ soll Erkenntnisse über Wertvorstellungen, den Bildungsgrad, Erwerbsbiografien sowie Fluchtursachen und -erfahrungen von Flüchtlingen in Deutschland bringen.
Am 15.11.2016 stellte das BAMF nun Ergebnisse eines ersten Teils der Befragung in Form einer Kurzanalyse vor: Bei den bisher im Jahr 2016 befragten 2.349 Personen lassen sich viele Gemeinsamkeiten mit der deutschen Bevölkerung feststellen: 96 % der Schutzsuchenden befürworten ein demokratisches System und fühlen sich dem hiesigen Werteverständnis näher als demjenigen in ihrem Herkunftsland. Unterschiede zu Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit ergeben sich allerdings beim Thema „Gleichberechtigung von Männern und Frauen“: 29 % der Befragten stimmen der Aussage „Wenn eine Frau mehr Geld verdient als ihr Partner, führt dies zwangsläufig zu Problemen“ zu – bei der deutschen Vergleichsgruppe teilen nur 18 % diese Einschätzung. Der Wunsch nach Bildung unter den Befragten ist hoch. Zwar wollen viele erst einmal arbeiten, aber später in Bildung und Ausbildung investieren. In ihrem Herkunftsland haben 58 % der befragten Neuangekommenen zehn Jahre oder länger eine Schule besucht – in Deutschland trifft das auf 88 % der Bevölkerung zu. 73 % waren vor der Flucht erwerbstätig, im Durchschnitt 6,4 Jahre lang. Über den konkreten Zugang zum Arbeitsmarkt hat der überwiegende Teil der Befragten bisher nur vage Vorstellungen, fast alle zeigen jedoch eine starke Arbeitsmotivation und Integrationsbereitschaft.
BAMF: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten. Flucht, Ankunft in Deutschland und erste Schritte der Integration (PDF, 0,7 MB)
by Redaktion

Dortmund/Köln (idr). Das Dortmunder Transorient Orchestra erhält den WDR-Jazzpreis 2017 in der neuen Kategorie „Musikkulturen“. Die Preisverleihung und die Preisträgerkonzerte finden im Rahmen des WDR 3 Jazzfests am 3. Februar im Stadttheater Gütersloh statt.
Gitarrist Andreas Heuser gründete 2003 das Orchester, in dem Musiker aus zahlreichen Ländern und Kulturen spielen. Getreu dem Motto „Der Orient beginnt im Ruhrgebiet“ vereint es in seiner Musik Jazz mit Sounds aus der Türkei, dem Balkan und dem arabischen Raum.
Die anderen Preisträger des WDR-Jazzpreises 2017 sind Jens Böckamp in der Sparte „Komposition“ sowie Pianist Jürgen Friedrich in der Kategorie „Improvisation“.
Infos: wdr3.de
by Redaktion

Wir sind im Krieg. Aber gegen wen? Wo ist Feindesland, wo Heimat? Was verteidigen wir, und zu welchem Preis? In einem Doppelabend aus zwei aktuellen Theaterstücken beleuchtet Anselm Weber in seiner vorletzten Bochumer Inszenierung unterschiedliche Facetten dieser drängenden Fragen:
Im Gewand eines Politthrillers verhandelt der amerikanische Pulitzer-Preisträger Ayad Akhtarmit „Die unsichtbare Hand“ („The invisible hand“) komplexe Themen: kulturelle Identität, Markt und Moral, Religion und Ideologie, Terror und Freiheitskampf. Entführt von einer Islamistengruppe, wird der amerikanische Investmentbanker Nick Bright im ländlichen Pakistan gefangen gehalten. Niemand, weder der amerikanische Staat noch sein Arbeitgeber, wird die Lösegeldforderungen der Entführer erfüllen. Verzweifelt schlägt Nick den Islamisten einen Deal vor. Es spielen Omar El-Saeidi, Heiko Raulin, Matthias Redlhammer und Samuel Simon.
In „Am Boden“ („Grounded“) berichtet eine junge US-Pilotin – gespielt von Sarah Grunert – wie sie nach der Geburt ihrer Tochter das Cockpit eines F-16 Kampfflugzeuges über der irakischen Wüste gegen den Steuerknüppel einer Kampfdrohne eintauschen muss. George Brants genau recherchierter Monolog ist ein eindrückliches Zeugnis vom „Drohnen-Krieg gegen den Terror“. Er erzählt davon, wie das ferngesteuerte Töten die Grenze zwischen Alltag und Krieg einstürzen lässt.
Die deutschsprachige Erstaufführung („Die unsichtbare Hand“) bzw. Premiere („Am Boden“) ist am 3. Dezember in den Kammerspielen.
Vor drei Jahren, im Dezember 2013, entwickelte Martina van Boxen zusammen mit jungen Erwachsenen aus Bochum, minderjährigen Flüchtlingen aus der ganzen Welt und Jugendlichen aus betreuten Wohngruppen das Tanz- und Theaterstück „Da-Heim“, das vor dem Hintergrund von Heimat, Familie, Flucht und Vertreibung vom Da-Heim-Sein erzählte. Die erfolgreiche Aufführung wurde 2014 zum Tanztreffen der Jugend der Berliner Festspiele eingeladen. Mit dem Nachfolgeprojekt „Über Gott und die Welt“ stellen sich Regisseurin Martina van Boxen, Choreograf Arthur Schopa und eine Gruppe junger Menschen jetzt den Fragen des Glaubens. Mithilfe des Tanzes und unter Einbeziehung biografischer Texte bezweifeln, hinterfragen und beleuchten sie das, was jeden Einzelnen von uns betrifft, die Welt verändern und prägen kann und doch schwer greifbar bleibt. Die Uraufführung von „Über Gott und die Welt“ ist am 1. Dezember im Theater Unten.
by Redaktion
Liebes Orga-Team!
Vielen Dank für das Konzert. 301,40 EUR Cash gab es für die Flüchtlingshilfe. Und auch die anwesenden Flüchtlinge waren begeistert von eurer Worldmusic, eurem Rock, Punk und Ska.
Wir freuen uns auf die Wiederholung!
by Redaktion
Historische Postkarte, 1908; Archiv: Dokumentations- und Kulturzentrum
In der dritten Gesprächsrunde „Impulse. Fotografie im Ruhrgebiet“ geht es um die Inszenierung des Fremden.Dabei rückt die Rolle visueller Medien bei der Ausformung des „Zigeuner“-Stereotyps in den Fokus.
Am 1. Dezember 2016 stellt Dr. Frank Reuter im Kokskohlenbunker neben dem Ruhr Museum ab 18 Uhr sein aktuelles Projekt zum Thema „Der Bann des Fremden: Die fotografische Konstruktion des ‚Zigeuners‘“ vor, mit dem er Impulse setzt und die Grundlage liefert für das anschließende Gespräch mit der Leiterin der Fotografischen Sammlung des Ruhr Museums, Stefanie Grebe.
Frank Reuter hat seine langjährigen Forschungen im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma und seine Arbeit als Ausstellungsmacher in seiner Dissertation dokumentiert. Historische Bildforschung und Stereotypenforschung sind die zentralen Methoden des Buches, das sich dem wichtigen Thema der Wirkmacht fotografischer Bilder widmet. Ihnen versucht der Autor eine kritische Analyse und eine menschliche Sprache entgegenzusetzen.
Stefanie Grebe war viele Jahre als freiberufliche Kuratorin, Dozentin, Fotografin und Publizistin tätig, seit Mitte der 1990er Jahre am Ruhrlandmuseum (und später im Ruhr Museum) maßgeblich an Ausstellungsprojekten beteiligt und ist seit Anfang Januar 2015 die Leiterin der Fotografischen Sammlung des Ruhr Museums.
Gesprächsrunde: Impulse. Fotografie im Ruhrgebiet // 1. Dezember 2016 // Der Bann des Fremden: Die fotografische Konstruktion des „Zigeuners“
Kosten
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Adresse
Ruhr Museum, UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal A [Schacht XII], Kokskohlenbunker [A16], Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen
by Redaktion
 Duisburg (idr/bs). Duisburg ist als zweite Stadt im Ruhrgebiet der europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) beigetreten. Auf Basis eines vorgegebenen Zehn-Punkte-Aktionsplans hat die Stadt Duisburg in enger Zusammenarbeit mit Initiativen, Netzwerken und Partnern ihre Ziele definiert. Sie setzt sich u.a. für Chancengleichheit, bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten und kulturelle Vielfalt ein.
Duisburg (idr/bs). Duisburg ist als zweite Stadt im Ruhrgebiet der europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) beigetreten. Auf Basis eines vorgegebenen Zehn-Punkte-Aktionsplans hat die Stadt Duisburg in enger Zusammenarbeit mit Initiativen, Netzwerken und Partnern ihre Ziele definiert. Sie setzt sich u.a. für Chancengleichheit, bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten und kulturelle Vielfalt ein.
Die UNESCO-Städtekoalition gegen Rassismus besteht seit 2004. In dem Bündnis sind mehr als 100 Städte aus 22 Nationen vertreten, darunter auch Dortmund (seit 2015). In Waltrop wird eine entsprechende Initiative von einer interfraktionellen Runde aus SPD, Bündnis 90/ Grüne, Die Linke und Waltroper Aufbruch (WA), getragen.